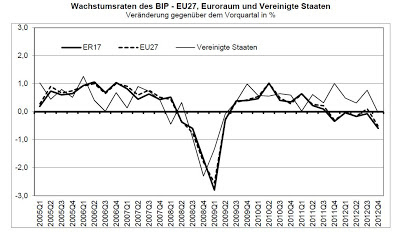Ben Bernanke hat vor dem Bankenausschuss des
Senats gestern zum ersten Mal überhaupt eine deutliche Aussage darüber gemacht,
dass grosse amerikanische Banken implizite Subventionen erhalten.
Der
Fed-Chef wird daher von Simon Johnson
in einem lesenswerten Artikel („Bernanke’s
Credibility on Too Big to Fail“) in NYTimes dazu gratuliert, ehrlich und direct
im Hinblick auf diesen wichtigen Punkt zu sein.
Leider
sind die Antworten Bernankes darauf, wie das Problem angegangen werden soll,
enttäuschend, bemerkt der an der MIT
Sloan School of Management lehrende Wirtschaftsprofessor.
Senatorin
Elizabeth Warren hat in der Anhörung auf einen Bericht von Bloomberg View hingewiesen, wonach grosse amerikanische Banken jährlich
Subventionen in Höhe von 83 Mrd. USD
einstreichen.
Anat Admati und Martin Hellwig befassen sich in ihrem neulich vorgelegten lesenswerten Buch („The Bankers‘ New Clothes“) mit
dem Thema Banken-Subventionen in einem sehr interessanten Kapitel (chapter 9:
Sweet Subsidies) ausführlich.
Bernanke scheint zu leugnen, ob das Problem von TBTF im Rückzug ist, unterstreicht
Johnson. Der Fed-Chef hat in der Anhörung gesagt, dass der Markt falsch liege
und es keine Rettungsaktionen (bailouts)
geben werde. Marktteilnehmer verstehen alles, dass Bernankes Versprechen nicht
zeit-konsistent ist, d.h., dass er jetzt sagen kann, was er will. In der
nächsten Krise wird aber gezwungen sein, eine effektive Hilfestellung für die
Vermögenswerte und die grossen Finanzinstitutionen zu leisten, argumentiert
Johnson.